



PARIETALE
OSTEOPATHIE
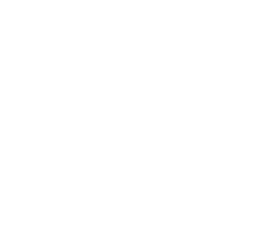
Anders als oft angenommen, arbeitet die parietale Osteopathie nicht nur an der Stelle, wo der Schmerz auftritt. Vielmehr betrachtet sie den Körper als vernetztes System, in dem ein Problem im Fuß durchaus zu Nackenschmerzen führen kann. Das Prinzip dahinter: Unser Körper kompensiert permanent kleine Störungen, bis diese Kompensation selbst zum Problem wird.
Mögliche Beschwerden in diesem Bereich:
Studien der letzten Jahre haben revolutioniert, wie wir Faszien verstehen. Lange Zeit galten sie als passive "Verpackung" für Muskeln. Heute wissen wir, dass Faszien aktive Strukturen sind voller Nervenendigungen und kontraktiler Zellen. Sie können sich eigenständig zusammenziehen, Schmerzsignale senden und sogar Bewegungen koordinieren (Schleip & Klingler, 2019).
Das Fasziensystem als Informationsnetzwerk
Faszien sind reich an Schmerzrezeptoren und Nervenendigungen, was erklärt, warum viele vermeintliche "Muskelschmerzen" tatsächlich fasziale Probleme sein könnten. Zudem fungieren Faszien als mechanisches Kommunikationssystem. Aktuelle Forschungen zeigen, dass anatomische Kontinuitäten zwischen Muskeln existieren, über die sich Spannungen übertragen können. Eine Störung in der Fußfaszie kann theoretisch über solche "myofaszialen Ketten" bis in entfernte Körperregionen ausstrahlen (Wilke et al., 2016; Krause et al., 2016).
Wichtig ist jedoch zu beachten, dass diese Erkenntnisse hauptsächlich aus Laborstudien stammen. Die klinische Bedeutung dieser faszialen Verbindungen ist noch Gegenstand intensiver Forschung. Im Praxisalltag hat sich dieses Prinzip jedoch bereits lange bewährt.
Der Teufelskreis der Fehlkompensation
Wenn ein Gelenk schmerzt oder eingeschränkt ist, entwickelt das Nervensystem automatisch Ausweichbewegungen. Zunächst sind diese Kompensationen hilfreich, denn sie ermöglichen uns, trotz einer Verletzung funktionsfähig zu bleiben. Problematisch wird es, wenn diese Notlösungen zur Gewohnheit werden und neue Spannungsmuster schaffen.
Mit der Zeit verschiebt sich oft das Schmerzempfinden: Das ursprünglich betroffene Gelenk wird nicht mehr als Problem wahrgenommen, stattdessen entstehen Beschwerden in den Bereichen, die durch die Kompensation überlastet wurden. Ein klassisches Beispiel: Ein steifes Sprunggelenk kann zu Knieschmerzen führen, ohne dass das eigentliche Problem im Fuß noch bewusst wahrgenommen wird. Die parietale Osteopathie arbeitet daher auf beiden Ebenen: Sie behandelt sowohl die sichtbaren Fehlhaltungen als auch die oft versteckten ursprünglichen Ursachen
Die Kraft des Verstehens: Schmerzerziehung:
Die Schmerzforschung zeigt, dass gezielte therapeutische Interventionen die sensomotorische Repräsentation positiv beeinflussen können. Studien belegen, dass Schmerzerziehung (das Vermitteln von Wissen über Schmerzmechanismen) messbare Verbesserungen bei chronischen Schmerzen bewirken kann (Moseley, 2002; Moseley, 2004). Das in "Explain Pain" entwickelte Konzept zeigt, dass das Verständnis der neurobiologischen Grundlagen von Schmerz dabei helfen kann, chronische Beschwerden zu überwinden und neue Bewegungsmuster zu etablieren (Butler & Moseley, 2013).
Insbesondere konnte gezeigt werden, dass Edukation über Schmerzneurophysiologie nicht nur die Schmerzwahrnehmung, sondern auch die körperliche Leistungsfähigkeit verbessern kann. Dies ist ein direkter Beleg für die Veränderbarkeit der sensomotorischen Repräsentation durch Wissen (Moseley et al., 2004).
Die Wirkung gezielten Drucks:
Die Forschung zur "Mechanotherapie", dem therapeutischen Einsatz mechanischer Kräfte, zeigt, dass gezielte mechanische Stimuli zelluläre Anpassungsprozesse auslösen können, die zur Gewebeheilung und -regeneration beitragen (Khan & Scott, 2009). Mechanische Signale können die Genexpression beeinflussen und Proteinsyntheseprocesse aktivieren, die für die Gewebereparatur essentiell sind (Thompson et al., 2012).
Studien zur manuellen Therapie belegen, dass mechanische Interventionen messbare neurologische und biomechanische Veränderungen bewirken. Manuelle Techniken können sowohl lokale Gewebereaktionen als auch zentrale Schmerzverarbeitungsmechanismen beeinflussen (Bialosky et al., 2009). Die Anwendung spezifischer mechanischer Kräfte kann dabei die Aktivität von Nervenbahnen modulieren und therapeutische Effekte auslösen (Reed et al., 2014).
In der Faszienforschung zeigt sich, dass mechanische Stimulation die Eigenschaften des Bindegewebes positiv beeinflussen kann, was die Grundlage für faszienorientierte Behandlungsansätze bildet (Chaitow, 2018).
Stress und Schmerz
Ein oft übersehener Aspekt der parietalen Osteopathie ist ihre Wirkung auf das vegetative Nervensystem. Chronische Schmerzen und Bewegungseinschränkungen aktivieren dauerhaft die Stressreaktion des Körpers. Dies führt zu einem Teufelskreis: Stress verstärkt Muskelspannung, was wiederum Schmerzen und Bewegungseinschränkungen verschlimmert. Gezielte osteopathische Techniken können den Vagusnerv stimulieren, den Hauptnerv unseres Entspannungssystems, und so einen Weg aus dem Teufelskreis aus Stress und Schmerz ermöglichen (Henley et al., 2008, Carnevali et al., 2020).
Wissenschaftliche Evidenz für parietale Osteopathie
Die Wirksamkeit osteopathischer Behandlungen des Bewegungsapparats ist in systematischen Übersichtsarbeiten untersucht worden. Eine umfassende Meta-Analyse von 2014 untersuchte die Wirksamkeit osteopathischer Behandlungen bei chronischen Rückenschmerzen und fand signifikante Verbesserungen sowohl bei Schmerzen als auch bei der Funktionsfähigkeit (Franke et al., 2014).
Eine frühere systematische Übersichtsarbeit mit sechs randomisierten kontrollierten Studien zeigte bereits 2005, dass osteopathische Behandlungen Rückenschmerzen signifikant reduzierten, wobei die Schmerzreduktion größer war als bei Placebo-Effekten zu erwarten und mindestens drei Monate anhielt (Licciardone et al., 2005).
Für Nackenschmerzen zeigt eine große randomisierte kontrollierte Studie mit 97 Teilnehmern, dass osteopathische Behandlungen bei chronischen Nackenschmerzen nicht nur Schmerzen reduzierten, sondern auch Schlaf, Müdigkeit und Depression verbesserten (Cholewicki et al., 2022).
Wie jede Behandlungsmethode hat auch die parietale Osteopathie ihre Grenzen.
Strukturelle Schäden: Bei schweren strukturellen Problemen wie fortgeschrittener Arthrose, Knochenbrüchen oder akuten Bandscheibenvorfällen mit neurologischen Ausfällen ist zunächst eine medizinische Abklärung erforderlich. Osteopathie kann hier nur begleitend angewendet werden.
Realistische Erwartungen: Chronische Probleme, die über Jahre entstanden sind, benötigen Zeit zur Regeneration. Ein "Wunder" nach einer Sitzung ist nicht zu erwarten. Nachhaltige Verbesserung erfordert meist einen Behandlungsplan über mehrere Wochen, wenn nicht Monate.
Individuelle Unterschiede: Jeder Körper reagiert anders. Was bei einem Patienten hervorragend funktioniert, kann bei einem anderen weniger erfolgreich sein. Dies hängt von vielen Faktoren ab: Alter, Fitness, Stress, anderen Erkrankungen und der individuellen Gewebequalität.
Ergänzung, kein Ersatz: Parietale Osteopathie versteht sich als Ergänzung zu anderen Behandlungsformen, nicht als deren Ersatz. Gerade bei Beschwerden im Bewegungsapparat ist eine begleitende Physio- oder Sporttherapeutische Behandlung sinnvoll.
Bitte beachten Sie: Die oben genannten Beschwerden sind lediglich Beispiele, um den parietalen Ansatz anschaulich zu erklären. Eine Besserung der Beschwerden kann nicht zugesichert werden, jeder Fall ist individuell.
1. Schleip, R., & Klingler, W. (2019). Active contractile properties of fascia. Clinical Anatomy, 32(7), 891–895. https://doi.org/10.1002/ca.23391
2. Schleip, R., Klingler, W., & Lehmann-Horn, F. (2005). Active fascial contractility: Fascia may be able to contract in a smooth muscle-like manner and thereby influence musculoskeletal dynamics. Medical Hypotheses, 65(2), 273–277. https://doi.org/10.1016/j.mehy.2005.03.005
3. Schleip, R., Naylor, I. L., Ursu, D., Melzer, W., Zorn, A., Wilke, H. J., Lehmann-Horn, F., & Klingler, W. (2006). Passive muscle stiffness may be influenced by active contractility of intramuscular connective tissue. Medical Hypotheses, 66(1), 66–71. https://doi.org/10.1016/j.mehy.2005.08.025
4. Wilke, J., Krause, F., Vogt, L., & Banzer, W. (2016). What Is Evidence-Based About Myofascial Chains: A Systematic Review. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 97(3), 454–461. https://doi.org/10.1016/j.apmr.2015.07.023
5. Krause, F., Wilke, J., Vogt, L., & Banzer, W. (2016). Intermuscular force transmission along myofascial chains: a systematic review. Journal of Anatomy, 228(6), 910–918. https://doi.org/10.1111/joa.12464
6. Wilke, J., & Krause, F. (2019). Myofascial chains of the upper limb: A systematic review of anatomical studies. Clinical Anatomy, 32(7), 934–940. https://doi.org/10.1002/ca.23424
7. Tesarz, J., Hoheisel, U., Wiedenhöfer, B., & Mense, S. (2011). Sensory innervation of the thoracolumbar fascia in rats and humans. Neuroscience, 194, 302–308. https://doi.org/10.1016/j.neuroscience.2011.07.066
8. Stecco, C., Stern, R., Porzionato, A., Macchi, V., Masiero, S., Stecco, A., & De Caro, R. (2011). Hyaluronan within fascia in the etiology of myofascial pain. Surgical and Radiologic Anatomy, 33(10), 891–896. https://doi.org/10.1007/s00276-011-0876-9
9. Wilke, J., Schleip, R., Yucesoy, C. A., & Banzer, W. (2018). Not merely a protective packing organ? A review of fascia and its force transmission capacity. Journal of Applied Physiology, 124(1), 234–244. https://doi.org/10.1152/japplphysiol.00565.2017
10. Butler, D. S., & Moseley, G. L. (2013). Explain Pain (2nd ed.). Noigroup Publications.
11. Moseley, G. L. (2003). A pain neuromatrix approach to patients with chronic pain. Manual Therapy, 8(3), 130–140. https://doi.org/10.1016/S1356-689X(03)00051-1
12. Melzack, R. (1999). From the gate to the neuromatrix. Pain, Supplement 6, S121–S126. https://doi.org/10.1016/S0304-3959(99)00145-1
13. Moseley, G. L. (2002). Combined physiotherapy and education is efficacious for chronic low back pain. Australian Journal of Physiotherapy, 48(4), 297–302. https://doi.org/10.1016/S0004-9514(14)60169-0
14. Moseley, G. L. (2004). Evidence for a direct relationship between cognitive and physical change during an education intervention in people with chronic low back pain. European Journal of Pain, 8(1), 39–45. https://doi.org/10.1016/S1090-3801(03)00063-6
15. Moseley, G. L., Nicholas, M. K., & Hodges, P. W. (2004). A randomized controlled trial of intensive neurophysiology education in chronic low back pain. Clinical Journal of Pain, 20(5), 324–330. https://doi.org/10.1097/00002508-200409000-00007
16. Bialosky, J. E., Bishop, M. D., Price, D. D., Robinson, M. E., & George, S. Z. (2009). The mechanisms of manual therapy in the treatment of musculoskeletal pain: a comprehensive model. Manual Therapy, 14(5), 531–538. https://doi.org/10.1016/j.math.2008.09.001
17. Chaitow, L. (2018). Fascial well-being: Mechanotransduction in manual and movement therapies. Journal of Bodywork and Movement Therapies, 22(1), 196–204. https://doi.org/10.1016/j.jbmt.2017.11.012
18. Khan, K. M., & Scott, A. (2009). Mechanotherapy: how physical therapists‘ prescription of exercise promotes tissue repair. British Journal of Sports Medicine, 43(4), 247–252. https://doi.org/10.1136/bjsm.2008.054239
19. Reed, W. R., Pickar, J. G., Sozio, R. S., & Long, C. R. (2014). Effect of spinal manipulation thrust magnitude on trunk mechanical thresholds of lateral thalamic neurons. Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics, 37(5), 277–286. https://doi.org/10.1016/j.jmpt.2014.04.005
20. Thompson, W. R., Rubin, C. T., & Rubin, J. (2012). Mechanical regulation of signaling pathways in bone. Gene, 503(2), 179–193. https://doi.org/10.1016/j.gene.2012.04.076
21. Henley, C. E., Ivins, D., Mills, M., Wen, F. K., & Benjamin, B. A. (2008). Osteopathic manipulative treatment and its relationship to autonomic nervous system activity as demonstrated by heart rate variability: a repeated measures study. Osteopathic Medicine and Primary Care, 2, 7. https://doi.org/10.1186/1750-4732-2-7
22. Carnevali, L., Lombardi, L., Fornari, M., & Sgoifo, A. (2020). Exploring the Effects of Osteopathic Manipulative Treatment on Autonomic Function Through the Lens of Heart Rate Variability. Frontiers in Neuroscience, 14, 579365. https://doi.org/10.3389/fnins.2020.579365
23. Franke, H., Franke, J. D., & Fryer, G. (2014). Osteopathic manipulative treatment for nonspecific low back pain: a systematic review and meta-analysis. BMC Musculoskeletal Disorders, 15, 286. https://doi.org/10.1186/1471-2474-15-286
24. Licciardone, J. C., Brimhall, A. K., & King, L. N. (2005). Osteopathic manipulative treatment for low back pain: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. BMC Musculoskeletal Disorders, 6, 43. https://doi.org/10.1186/1471-2474-6-43
25. Cholewicki, J., Popovich, J. M. Jr., Reeves, N. P., et al. (2022). The effects of osteopathic manipulative treatment on pain and disability in patients with chronic neck pain: A single-blinded randomized controlled trial. PM&R, 14(12), 1417–1429. https://doi.org/10.1002/pmrj.12732

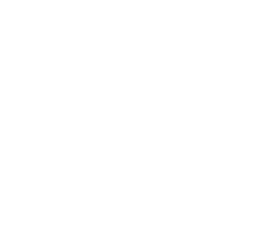
PARIETALE
OSTEOPATHIE
Anders als oft angenommen, arbeitet die parietale Osteopathie nicht nur an der Stelle, wo der Schmerz auftritt. Vielmehr betrachtet sie den Körper als vernetztes System, in dem ein Problem im Fuß durchaus zu Nackenschmerzen führen kann. Das Prinzip dahinter: Unser Körper kompensiert permanent kleine Störungen, bis diese Kompensation selbst zum Problem wird.
Mögliche Beschwerden in diesem Bereich:
Studien der letzten Jahre haben revolutioniert, wie wir Faszien verstehen. Lange Zeit galten sie als passive "Verpackung" für Muskeln. Heute wissen wir, dass Faszien aktive Strukturen sind voller Nervenendigungen und kontraktiler Zellen. Sie können sich eigenständig zusammenziehen, Schmerzsignale senden und sogar Bewegungen koordinieren (Schleip & Klingler, 2019).
Das Fasziensystem als Informationsnetzwerk
Faszien sind reich an Schmerzrezeptoren und Nervenendigungen, was erklärt, warum viele vermeintliche "Muskelschmerzen" tatsächlich fasziale Probleme sein könnten. Zudem fungieren Faszien als mechanisches Kommunikationssystem. Aktuelle Forschungen zeigen, dass anatomische Kontinuitäten zwischen Muskeln existieren, über die sich Spannungen übertragen können. Eine Störung in der Fußfaszie kann theoretisch über solche "myofaszialen Ketten" bis in entfernte Körperregionen ausstrahlen (Wilke et al., 2016; Krause et al., 2016).
Wichtig ist jedoch zu beachten, dass diese Erkenntnisse hauptsächlich aus Laborstudien stammen. Die klinische Bedeutung dieser faszialen Verbindungen ist noch Gegenstand intensiver Forschung. Im Praxisalltag hat sich dieses Prinzip jedoch bereits lange bewährt.
Der Teufelskreis der Fehlkompensation
Wenn ein Gelenk schmerzt oder eingeschränkt ist, entwickelt das Nervensystem automatisch Ausweichbewegungen. Zunächst sind diese Kompensationen hilfreich, denn sie ermöglichen uns, trotz einer Verletzung funktionsfähig zu bleiben. Problematisch wird es, wenn diese Notlösungen zur Gewohnheit werden und neue Spannungsmuster schaffen.
Mit der Zeit verschiebt sich oft das Schmerzempfinden: Das ursprünglich betroffene Gelenk wird nicht mehr als Problem wahrgenommen, stattdessen entstehen Beschwerden in den Bereichen, die durch die Kompensation überlastet wurden. Ein klassisches Beispiel: Ein steifes Sprunggelenk kann zu Knieschmerzen führen, ohne dass das eigentliche Problem im Fuß noch bewusst wahrgenommen wird. Die parietale Osteopathie arbeitet daher auf beiden Ebenen: Sie behandelt sowohl die sichtbaren Fehlhaltungen als auch die oft versteckten ursprünglichen Ursachen
Die Kraft des Verstehens: Schmerzerziehung:
Die Schmerzforschung zeigt, dass gezielte therapeutische Interventionen die sensomotorische Repräsentation positiv beeinflussen können. Studien belegen, dass Schmerzerziehung (das Vermitteln von Wissen über Schmerzmechanismen) messbare Verbesserungen bei chronischen Schmerzen bewirken kann (Moseley, 2002; Moseley, 2004). Das in "Explain Pain" entwickelte Konzept zeigt, dass das Verständnis der neurobiologischen Grundlagen von Schmerz dabei helfen kann, chronische Beschwerden zu überwinden und neue Bewegungsmuster zu etablieren (Butler & Moseley, 2013).
Insbesondere konnte gezeigt werden, dass Edukation über Schmerzneurophysiologie nicht nur die Schmerzwahrnehmung, sondern auch die körperliche Leistungsfähigkeit verbessern kann. Dies ist ein direkter Beleg für die Veränderbarkeit der sensomotorischen Repräsentation durch Wissen (Moseley et al., 2004).
Die Wirkung gezielten Drucks:
Die Forschung zur "Mechanotherapie", dem therapeutischen Einsatz mechanischer Kräfte, zeigt, dass gezielte mechanische Stimuli zelluläre Anpassungsprozesse auslösen können, die zur Gewebeheilung und -regeneration beitragen (Khan & Scott, 2009). Mechanische Signale können die Genexpression beeinflussen und Proteinsyntheseprocesse aktivieren, die für die Gewebereparatur essentiell sind (Thompson et al., 2012).
Studien zur manuellen Therapie belegen, dass mechanische Interventionen messbare neurologische und biomechanische Veränderungen bewirken. Manuelle Techniken können sowohl lokale Gewebereaktionen als auch zentrale Schmerzverarbeitungsmechanismen beeinflussen (Bialosky et al., 2009). Die Anwendung spezifischer mechanischer Kräfte kann dabei die Aktivität von Nervenbahnen modulieren und therapeutische Effekte auslösen (Reed et al., 2014).
In der Faszienforschung zeigt sich, dass mechanische Stimulation die Eigenschaften des Bindegewebes positiv beeinflussen kann, was die Grundlage für faszienorientierte Behandlungsansätze bildet (Chaitow, 2018).
Stress und Schmerz
Ein oft übersehener Aspekt der parietalen Osteopathie ist ihre Wirkung auf das vegetative Nervensystem. Chronische Schmerzen und Bewegungseinschränkungen aktivieren dauerhaft die Stressreaktion des Körpers. Dies führt zu einem Teufelskreis: Stress verstärkt Muskelspannung, was wiederum Schmerzen und Bewegungseinschränkungen verschlimmert. Gezielte osteopathische Techniken können den Vagusnerv stimulieren, den Hauptnerv unseres Entspannungssystems, und so einen Weg aus dem Teufelskreis aus Stress und Schmerz ermöglichen (Henley et al., 2008, Carnevali et al., 2020).
Wissenschaftliche Evidenz für parietale Osteopathie
Die Wirksamkeit osteopathischer Behandlungen des Bewegungsapparats ist in systematischen Übersichtsarbeiten untersucht worden. Eine umfassende Meta-Analyse von 2014 untersuchte die Wirksamkeit osteopathischer Behandlungen bei chronischen Rückenschmerzen und fand signifikante Verbesserungen sowohl bei Schmerzen als auch bei der Funktionsfähigkeit (Franke et al., 2014).
Eine frühere systematische Übersichtsarbeit mit sechs randomisierten kontrollierten Studien zeigte bereits 2005, dass osteopathische Behandlungen Rückenschmerzen signifikant reduzierten, wobei die Schmerzreduktion größer war als bei Placebo-Effekten zu erwarten und mindestens drei Monate anhielt (Licciardone et al., 2005).
Für Nackenschmerzen zeigt eine große randomisierte kontrollierte Studie mit 97 Teilnehmern, dass osteopathische Behandlungen bei chronischen Nackenschmerzen nicht nur Schmerzen reduzierten, sondern auch Schlaf, Müdigkeit und Depression verbesserten (Cholewicki et al., 2022).
Wie jede Behandlungsmethode hat auch die parietale Osteopathie ihre Grenzen.
Strukturelle Schäden: Bei schweren strukturellen Problemen wie fortgeschrittener Arthrose, Knochenbrüchen oder akuten Bandscheibenvorfällen mit neurologischen Ausfällen ist zunächst eine medizinische Abklärung erforderlich. Osteopathie kann hier nur begleitend angewendet werden.
Realistische Erwartungen: Chronische Probleme, die über Jahre entstanden sind, benötigen Zeit zur Regeneration. Ein "Wunder" nach einer Sitzung ist nicht zu erwarten. Nachhaltige Verbesserung erfordert meist einen Behandlungsplan über mehrere Wochen, wenn nicht Monate.
Individuelle Unterschiede: Jeder Körper reagiert anders. Was bei einem Patienten hervorragend funktioniert, kann bei einem anderen weniger erfolgreich sein. Dies hängt von vielen Faktoren ab: Alter, Fitness, Stress, anderen Erkrankungen und der individuellen Gewebequalität.
Ergänzung, kein Ersatz: Parietale Osteopathie versteht sich als Ergänzung zu anderen Behandlungsformen, nicht als deren Ersatz. Gerade bei Beschwerden im Bewegungsapparat ist eine begleitende Physio- oder Sporttherapeutische Behandlung sinnvoll.
Bitte beachten Sie: Die oben genannten Beschwerden sind lediglich Beispiele, um den parietalen Ansatz anschaulich zu erklären. Eine Besserung der Beschwerden kann nicht zugesichert werden, jeder Fall ist individuell.
1. Schleip, R., & Klingler, W. (2019). Active contractile properties of fascia. Clinical Anatomy, 32(7), 891–895. https://doi.org/10.1002/ca.23391
2. Schleip, R., Klingler, W., & Lehmann-Horn, F. (2005). Active fascial contractility: Fascia may be able to contract in a smooth muscle-like manner and thereby influence musculoskeletal dynamics. Medical Hypotheses, 65(2), 273–277. https://doi.org/10.1016/j.mehy.2005.03.005
3. Schleip, R., Naylor, I. L., Ursu, D., Melzer, W., Zorn, A., Wilke, H. J., Lehmann-Horn, F., & Klingler, W. (2006). Passive muscle stiffness may be influenced by active contractility of intramuscular connective tissue. Medical Hypotheses, 66(1), 66–71. https://doi.org/10.1016/j.mehy.2005.08.025
4. Wilke, J., Krause, F., Vogt, L., & Banzer, W. (2016). What Is Evidence-Based About Myofascial Chains: A Systematic Review. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 97(3), 454–461. https://doi.org/10.1016/j.apmr.2015.07.023
5. Krause, F., Wilke, J., Vogt, L., & Banzer, W. (2016). Intermuscular force transmission along myofascial chains: a systematic review. Journal of Anatomy, 228(6), 910–918. https://doi.org/10.1111/joa.12464
6. Wilke, J., & Krause, F. (2019). Myofascial chains of the upper limb: A systematic review of anatomical studies. Clinical Anatomy, 32(7), 934–940. https://doi.org/10.1002/ca.23424
7. Tesarz, J., Hoheisel, U., Wiedenhöfer, B., & Mense, S. (2011). Sensory innervation of the thoracolumbar fascia in rats and humans. Neuroscience, 194, 302–308. https://doi.org/10.1016/j.neuroscience.2011.07.066
8. Stecco, C., Stern, R., Porzionato, A., Macchi, V., Masiero, S., Stecco, A., & De Caro, R. (2011). Hyaluronan within fascia in the etiology of myofascial pain. Surgical and Radiologic Anatomy, 33(10), 891–896. https://doi.org/10.1007/s00276-011-0876-9
9. Wilke, J., Schleip, R., Yucesoy, C. A., & Banzer, W. (2018). Not merely a protective packing organ? A review of fascia and its force transmission capacity. Journal of Applied Physiology, 124(1), 234–244. https://doi.org/10.1152/japplphysiol.00565.2017
10. Butler, D. S., & Moseley, G. L. (2013). Explain Pain (2nd ed.). Noigroup Publications.
11. Moseley, G. L. (2003). A pain neuromatrix approach to patients with chronic pain. Manual Therapy, 8(3), 130–140. https://doi.org/10.1016/S1356-689X(03)00051-1
12. Melzack, R. (1999). From the gate to the neuromatrix. Pain, Supplement 6, S121–S126. https://doi.org/10.1016/S0304-3959(99)00145-1
13. Moseley, G. L. (2002). Combined physiotherapy and education is efficacious for chronic low back pain. Australian Journal of Physiotherapy, 48(4), 297–302. https://doi.org/10.1016/S0004-9514(14)60169-0
14. Moseley, G. L. (2004). Evidence for a direct relationship between cognitive and physical change during an education intervention in people with chronic low back pain. European Journal of Pain, 8(1), 39–45. https://doi.org/10.1016/S1090-3801(03)00063-6
15. Moseley, G. L., Nicholas, M. K., & Hodges, P. W. (2004). A randomized controlled trial of intensive neurophysiology education in chronic low back pain. Clinical Journal of Pain, 20(5), 324–330. https://doi.org/10.1097/00002508-200409000-00007
16. Bialosky, J. E., Bishop, M. D., Price, D. D., Robinson, M. E., & George, S. Z. (2009). The mechanisms of manual therapy in the treatment of musculoskeletal pain: a comprehensive model. Manual Therapy, 14(5), 531–538. https://doi.org/10.1016/j.math.2008.09.001
17. Chaitow, L. (2018). Fascial well-being: Mechanotransduction in manual and movement therapies. Journal of Bodywork and Movement Therapies, 22(1), 196–204. https://doi.org/10.1016/j.jbmt.2017.11.012
18. Khan, K. M., & Scott, A. (2009). Mechanotherapy: how physical therapists‘ prescription of exercise promotes tissue repair. British Journal of Sports Medicine, 43(4), 247–252. https://doi.org/10.1136/bjsm.2008.054239
19. Reed, W. R., Pickar, J. G., Sozio, R. S., & Long, C. R. (2014). Effect of spinal manipulation thrust magnitude on trunk mechanical thresholds of lateral thalamic neurons. Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics, 37(5), 277–286. https://doi.org/10.1016/j.jmpt.2014.04.005
20. Thompson, W. R., Rubin, C. T., & Rubin, J. (2012). Mechanical regulation of signaling pathways in bone. Gene, 503(2), 179–193. https://doi.org/10.1016/j.gene.2012.04.076
21. Henley, C. E., Ivins, D., Mills, M., Wen, F. K., & Benjamin, B. A. (2008). Osteopathic manipulative treatment and its relationship to autonomic nervous system activity as demonstrated by heart rate variability: a repeated measures study. Osteopathic Medicine and Primary Care, 2, 7. https://doi.org/10.1186/1750-4732-2-7
22. Carnevali, L., Lombardi, L., Fornari, M., & Sgoifo, A. (2020). Exploring the Effects of Osteopathic Manipulative Treatment on Autonomic Function Through the Lens of Heart Rate Variability. Frontiers in Neuroscience, 14, 579365. https://doi.org/10.3389/fnins.2020.579365
23. Franke, H., Franke, J. D., & Fryer, G. (2014). Osteopathic manipulative treatment for nonspecific low back pain: a systematic review and meta-analysis. BMC Musculoskeletal Disorders, 15, 286. https://doi.org/10.1186/1471-2474-15-286
24. Licciardone, J. C., Brimhall, A. K., & King, L. N. (2005). Osteopathic manipulative treatment for low back pain: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. BMC Musculoskeletal Disorders, 6, 43. https://doi.org/10.1186/1471-2474-6-43
25. Cholewicki, J., Popovich, J. M. Jr., Reeves, N. P., et al. (2022). The effects of osteopathic manipulative treatment on pain and disability in patients with chronic neck pain: A single-blinded randomized controlled trial. PM&R, 14(12), 1417–1429. https://doi.org/10.1002/pmrj.12732
SAY
HELLO
ONA Osteopathie
Frankfurter Straße 25
61476 Kronberg im Taunus
+49 176 14 372 069
hi@ona-osteopathie.de
Instagram
SAY HELLO
ONA Osteopathie
Frankfurter Straße 25
61476 Kronberg im Taunus
+49 176 14 372 069
hi@ona-osteopathie.de